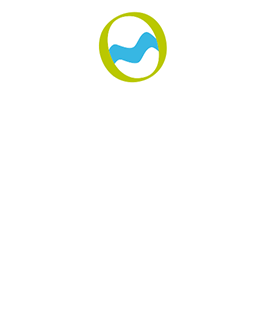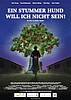Schloss Eurasburg
Bergpionier Hermann von Barth wurde auf Schloss Eurasburg geboren
Von Benjamin Engel
Eurasburg, 18.06.2020 – Als Hermann von Barth am 26. Juni 1870 das Plumser Joch erreicht, ist das Wetter schlecht. Es regnet und stürmt als der damals gerade einmal 25 Jahre alte Jurist auf die Gipfel im Westen blickt. „Der erste Felsenstock, der seine Zinnen aus den zerfetzten Wolkenstrichen mir entgegenreckte, war der Falk.“ So schreibt er in seinem Hauptwerk „Aus den nördlichen Kalkalpen“. Das ist der wetterumtoste Ausschnitt eines energetischen Gipfelsturms. Im Sommer vor 150 Jahren wird Hermann von Barth auf 88 Karwendel-Bergen rund um das Quellgebiet der Isar stehen. Weder widrige Witterungsbedingungen noch tiefe Klüfte oder schwindelerregende Talblicke können ihn stoppen. Packend schreibt der Bergsteiger von schmalen Grasbändern und Felsgesimsen, an denen er sich um Ecken über dem Abgrund entlang hangelt. Damit wird der junge Mann als systematischer Erforscher des Karwendel bekannt. Bis heute zählt Hermann von Barth zu den Bergpionieren im deutschen Alpenraum.
Hermann von Barth wurde am 5. Juni 1845 auf Schloss Eurasburg geboren
Nur unweit davon entfernt ist der Spross eines traditionsreichen bayerischen Patrizier- und Adelsgeschlechts am 5. Juni 1845 auf Schloss Eurasburg geboren. Seit dem 14. Jahrhundert war seine Familie auf dem kleinen Schloss Harmating auf der östlichen Isarseite ansässig. Als er heiratete, kam von Barths Großvater in den Besitz des Eurasburger Anwesens. Auf dem Plateau hoch über der Loisach wuchs Hermann von Barth als ältester von vier Brüdern auf. Sein Vater verkaufte Schloss Eurasburg allerdings 1857. Die Familie zog nach München, wo Hermann von Barth das Luisengymnasium besuchte. Nach dem Schulabschluss studierte er Jura. Den Bergen ganz nah kam Hermann von Barth, als er am 1. Mai 1868 bei seinem Onkel - dem Landrichter Ignaz von Barth-Harmating - in Berchtesgaden den Praktikantendienst begann. In nur vier Sommern erkundete der junge Mann die Berchtesgadener und Allgäuer Alpen, das Karwendel sowie das Wettersteingebirge – und das meist allein.
Durch seine Unternehmungen wurde Hermann von Barth damit zum Vorbild des führerlosen Bergsteigens. Was Zeitgenossen als unverantwortlich und gewissenlos kritisierten, unternahm er aber nicht, weil er bewusst das Risiko suchte oder sich in Gefahr begeben wollte. Wie die Münchner Kunsthistorikerin und Ausstellungskuratorin Stephanie Kleidt erläutert, habe der Bergsteiger stets darauf verwiesen, dass er Gipfel besteigen wolle, auf denen noch niemand gestanden habe. Deswegen könne ihm ein Führer auch nicht helfen. Daher müsse er allein gehen. „Dass er dazu in der Lage gewesen ist, begründet seinen Stellenwert unter Alpinisten bis heute“, sagt Kleidt. Sie hat die Ausstellung „Die Berge und wir“ im Alpinen Museum auf der Münchner Praterinsel zum 150-jährigen Bestehen des Deutschen Alpenvereins (DAV) mitkuratiert und sich im Ausstellungskatalog mit von Barth beschäftigt.
Zu der Zeit von Barths Touren sind im Karwendel fast nur Jäger, Kuh- und Schafhirten unterwegs. Trotz seiner rau-urwüchsigen Wildnis und jäh abstürzenden Felszacken erscheint das Gebirge für Bergsteiger unattraktiv. Sie wenden sich lieber höheren Gipfeln am zentralen Alpenhauptkamm zu. Die nördlichen Kalkalpen gelten als bloße „Vorberge“, wie Stephanie Kleidt erläutert. So mancher rümpft nur die Nase über Leute, die dort unterwegs sein wollen.
Das mag auch an der Topographie der Kalkalpen liegen. Denn stundenlang dauert der Aufstieg durch den Wald, ehe das „Freie der Bergeshöhen die Brust weitet“, wie von Barth in der Einleitung zu seinem Buch „Aus den Nördlichen Kalkalpen“ schreibt. Damit verlangten diese Berge mehr Mühe als das Gletschergebirge. Doch das nimmt von Barth auf sich. Es sei seit jeher einer seiner Lieblingsgedanken gewesen, zur Kenntnis der Alpen beizutragen, schreibt er. Und dazu findet er in den Kalkalpen reichlich Gelegenheit.
Als akademisch gebildeter Mann aus einer Adelsfamilie zählt er zu dem typischen Milieu der Bergsteiger der damaligen Zeit. Denn für ausgedehnte Touren in den Bergen braucht es Zeit und Geld. Beides fehlt der Arbeiterschicht. In den Mitgliedslisten des 1869 gegründeten Deutschen Alpenvereins finden sich daher viele Angehörige des Bildungsbürgertums wie Professoren.
Was sein Buch „Aus den nördlichen Kalkalpen“ zum Klassiker der Bergsteigerliteratur macht, sind die naturwissenschaftlich akribischen Beschreibungen etwa der Geologie, der Höhenstrukturen und -profile. Mit mehr als 600 Seiten zählt es zu den wenigen großen Abhandlungen über die Berge am nördlichen Alpenrand. „Seine Akribie und Systematik ist wirklich bemerkenswert“, berichtet Kleidt. Kurzweilig wird die Lektüre aber durch kleine Schilderungen von Land und Leuten. Er berichtet von kargen Abendessen mit den Hirten der Alphütten aus einer gemeinsamen mit Mehlbrei gefüllten Pfanne, schlaflosen, entsetzlich lang werdenden Nächten im Kuhstall unter dem nie enden wollenden Schellen der Tierglocken und so manch aus seiner Sicht phlegmatischen Reaktion auf seinen Drang zum Gipfel. Wenn Hermann von Barth einem Hirten etwa erzählt, dass ihm der Risser Falk höchst unzugänglich vorgekommen sei und nur die Antwort erhält, dass man dann wohl auch nicht hinaufkommen werde, schreibt er nur: „Ich muss aber hinauf.“
Daran kann ihn auch die die rau-urwüchsige Wildnis des Karwendel, von der er packend, wenngleich manchmal fast allzu pathetisch schreibt, nicht abhalten. „Kahles, den letzten Rest organischen Lebens unter seiner Schuttdecke begrabendes Gestein, – ein tausendfaches geborstenes Gerüste zackiger Mauern, aus eisigen Schlünden gleich erstarrten Flammen der Unterwelt zu unermesslicher Höhe emporzüngelnd, – und eine Dolchklinge darüber, drohend aufgezückt gegen den Himmel, so thront die Kaltwasserspitze über den Weidegründen von Ladiz“. Auf dem 2733 Meter hohen Berg ist Hermann von Barth 1870 im Sturm der Erstbesteiger. „Im Kampf mit dem entfesselten Element bin ich der Stärkere – und bin allein“, so schreibt er.
Heute ist das Karwendel kaum mehr so menschenleer wie einst. Die Faszination der Natur kann der Wanderer aber etwa im Vomper Loch noch spüren. In einem Seitenarm des Tiroler Inntals nahe der Stadt Schwaz hat sich der Bach tief in das bayerisch-österreichische Grenzgebirge eingeschnitten. Vom Grund ragt der Fels bis zu weit mehr als tausend Metern nach oben. Dort hat er Hermann von Barth vor 150 Jahren eine Nacht zwischen sich zu phantastischen Gestalten aufbauschenden Wolkenformationen und dem Mond, der die „zerspaltenen Wände“ in grelles Licht hüllt, verbracht. „In diesen, in dieser Umwallung unnahbarer Wände und Zinnen, in dieser pfadlosen Welt der Zerstörung wäre wohl des Höllenfürsten würdigste Residenz!“
Rastlos wirkt, auf wie vielen Gipfeln Hermann von Barth in nur vier Sommern ganz oben stand. 69 waren es allein in den Berchtesgadener Alpen. Auf zehn von ihnen war bis 1868 noch kein Mensch gewesen. Ein Jahr später wechselte von Barth nach Stationen in Traunstein und München an das Bezirksgericht Sonthofen. In wenigen Monaten erklomm er im Allgäu 44 Gipfel, unter anderem den Hochvogel. Im Sommer 1870 schaffte er es auf 88 Karwendelberge, auf zwölf davon als erster wie die östlichen Karwendel- oder die Vogelkarspitze. Im nächsten Sommer erkundete von Barth das Wettersteingebirge. Jahr für Jahr habe er eine einzelne naturgemäß umgrenzte Gruppe der nördlichen Kalkalpen sich erlesen und erwandert, schreibt er in seinem Buch „Aus den Nördlichen Kalkalpen“. Wenig kenne er in den Alpen, aber was er kenne, sei ihm im vollen Sinne des Wortes bekannt. Sein Buch solle für den Bergsteiger, der selten erreichte Ziele zu gewinnen strebe, ein Leitfaden der Kunst sein, mit starren Felsgestalten zurechtzukommen. „In die Thäler und Kare des Karwendel, an den massiven Stöcken der Mieminger Berge hinauf dringt wohl selten der touristische Schritt.“
Als sein Hauptwerk 1874 im Amthor Verlag erscheint, hat sich von Barth vom Bergsteigen schon wieder abgewendet. Womöglich haben ihn seine gescheiterten Veröffentlichungsversuche in den Jahren zuvor frustriert. Viele hundert Seiten füllen seine Aufzeichnungen, doch in den Druck schafft es davon kaum etwas. 1872 beendet von Barth seine juristische Laufbahn und beginnt erneut zu studieren. Er beschäftigt sich so intensiv mit Paläontologie und Geologie, dass für Bergsteigen keine Zeit mehr bleibt. 1875 promoviert er, legt in Paläontologie, Geologie und Mineralogie seine Prüfungen ab. In demselben Jahr veröffentlicht er ein Nachschlagewerk über Forschungsreisen in Afrika auf den Spuren von David Livingstone. Schließlich sucht die „Geographische Gesellschaft München“ nach einem bayerischen Wissenschaftler, der eine Expedition in Europas südlichen Nachbarkontinent begleiten soll. Hermann von Barth wird ausgewählt. Am 20. Januar 1876 schifft sich der junge Mann in Hamburg nach Lissabon ein. Genau am 5. Juni – seinem 31. Geburtstag – kommt er in San Paolo de Loanda in der portugiesischen Kolonie Angola an. Nach Europa zurückkehren wird von Barth nicht mehr. Wie Nachfahre Albert von Schirnding in einem Nachwort zu einem Nachdruck des Buches „Aus den nördlichen Kalkalpen“ schreibt, entwickelt sich bereits die erste Expedition ins Landesinnere zum Fiasko. In völlig entkräftetem Zustande sei er nach Loanda zurückgekehrt. Am 7. Dezember 1876 hat sich Hermann von Barth dort erschossen.
An den „Erforscher des Karwendel“ erinnert bis heute ein Denkmal im Kleinen Ahornboden
Das Denkmal hatte die Alpenvereinssektion Augsburg, der er angehörte, im Jahr 1881 aufstellen lassen. Seinen Namen tragen eine Hütte im Allgäu, der Hermann-von-Barth-Steig im Wettersteingebirge und die Barthspitze im Karwendel.
Auf die Berge schaffte es Hermann von Barth mit einer für heutige Zeitgenossen primitiv anmutenden Ausrüstung. Halt boten ihm der lange Bergstock und die Schuhe mit genagelten Sohlen. Im Rucksack hatte er etwa Wäsche zum Wechseln, ein Fernrohr, eine Flasche zum Wasserauffüllen und ein Notizbuch. Auf die Berge schleppte er aber auch eine Kaffeemaschine samt gemahlenem Kaffee, um auf dem Berg das Frühstück zu genießen. Mit heutigen Bergsteigern geteilt hat Hermann von Barth wohl das sogenannte „Runner’s High“ moderner Alpinisten, jenen euphorischen Zustand, bei dem bei großer körperlicher Anstrengung Endorphine ausgeschüttet werden und den Sportler in einen Rausch versetzen. Zumindest geht der Journalist Georg Bayerle davon aus. Daran erinnern die metaphysischen Beschreibungen von Barths nach einer Nacht auf dem Allgäuer Hochvogel, bei der der Sturmwind wundersame Melodien erzeugt und umflorte Nebelgestalten auftauchen, die durch das Sternengefunkel dahinzuschweben scheinen.
Fotos: Archiv Deutscher Alpenverein, Benjamin Engel, Silvan Metz

Auf den Spuren Hermann von Barths am Allgäuer Hochvogel Foto: ©Silvan Metz

Auf den Spuren Hermann von Barths am Allgäuer Hochvogel Foto: ©Silvan Metz

Auf den Spuren Hermann von Barths am Allgäuer Hochvogel Foto: ©Silvan Metz

Auf den Spuren Hermann von Barths am Allgäuer Hochvogel Foto: ©Silvan Metz

Auf den Spuren Hermann von Barths am Allgäuer Hochvogel Foto: ©Silvan Metz

Auf den Spuren Hermann von Barths am Allgäuer Hochvogel Foto: ©Benjamin Engel

Auf den Spuren Hermann von Barths am Allgäuer Hochvogel Foto: ©Benjamin Engel

Auf den Spuren Hermann von Barths am Allgäuer Hochvogel Foto: ©Silvan Metz